| |
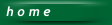 |
| |
|
| |
M
e n u e |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
 |
|

�ber alle Berge - Eine Bolivianische Zeitreise |
|
| |
Das
Einzige, was noch passabel aussieht sind unsere Lowa-Schuhe, die
einfach nicht kleinzukriegen sind. Vor dem Felsen, unter dem auch
die Zelte stehen, braust der Regen herab wie ein Wasserfall. Im
Zelt macht sich Feuchtigkeit breit. Ich bin hundemüde und werde
gut schlafen.
Am Morgen stelle
ich fest, daß mein Clopapier aufgeweicht ist. Der Kaffee und
die Kartoffeln sind alle, aber solange uns das Angelglück nicht
verläßt, haben wir genug zu essen. Das Wetter sieht gut
aus, die Wildwasser haben sich beruhigt. In kurzer Zeit erreichen
wir den gestrigen Umkehrpunkt, dort machen wir weiter, wo wir am
Tag zuvor aufhörten. Die Wegführung ist nicht leicht,
es gilt, etliche schwierige Passagen zu meistern. Ein schlüpfriger
Wasserfall versperrt uns den Weg, direkt unter unseren Füßen
rauscht er eine 100 Meter hohe, senkrechte Wand hinunter. Wir schlagen
Bambusrohre und sperriges Geäst, das wir als >Sicherung<
vor den Felsabbruch werfen, bis der Astverhau uns stark genug erscheint,
um den Sturz einer abrutschenden Person auffangen zu können.
Keiner von uns hat große Lust, unsere primitive Sicherung
auszuprobieren, wir ziehen es vor, nicht zu stürzen und schwindeln
uns einzeln über die heikle Passage hinüber, wobei uns
das weit von oben in freiem Fall herab rauschende Wasser eine ordentliche
Dusche verpaßt. Erneut sind wir tropfnass, aber es ist heute
so heiß, daß wir schnell wieder trocknen. Nach schwerer
Schufterei in dichtem Wald gelangen wir in baumloses Gelände,
in dem eine Art dichtes, sehr biegsames Schilf wächst, welches
sich fast nicht mit den Messern durchschlagen läßt. Wir
ersinnen eine brachiale Methode, um dem Schilf beizukommen: Einer
springt hoch, ein anderer schiebt ihn zusätzlich von hinten
an, er wirft sich von oben über die Vegetation und drückt
sie mit dem Körpergewicht nach unten, die anderen steigen über
ihn drüber und der nächste macht den >Rammbock<.
Dazwischen wächst gottlob immer wieder >nur< dicker Bambus,
den wir mit Macheten umhauen können. Nach drei Stunden unglaublicher
Schinderei sind wir fix und fertig, jeder hat blutende Schrammen
im Gesicht und wünscht sich nur eines: Endlich rauskommen in
freies Gelände. Die letzten 300 Meter sind nochmal verdammt
widerspenstig, doch dann sind wir draußen im Freien, in der
Sonne. Wir rennen auf einem zugewachsenen Pfad, der uns nach dem
harten Trip im Wald wie ein Weg vorkommt, hinunter zum Rio Llipichi,
wo wir uns in einer seichten Höhle einen wunderschönen
Zeltplatz herrichten. |
| |
|
|
Die
seichte Höhle vom Rio Llipichi. Wir nutzen sie um in ihr ein
Feuer zu entfachen, auf dem wir uns einen Tee zubereiten. Außerdem
trocknen wir hier auch unsere feuchte Kleidung. |
|
| |
Kurz
vor Einbruch der Dunkelheit entfachen wir ein Lagerfeuer, um die
Mücken in Schach zu halten. Der wunderschöne Zeltplatz
liegt direkt am Fluß und ist umgeben von steilen, dicht bewaldeten
Hängen. In der Dunkelheit geht ein Licht an, dann erlischt
es wieder: Ein Glühwürmchen blinkt mit seiner Taschenlampe.
Plötzlich die Antwort von hunderttausenden von Lichtern: Der
ganze Wald flackert, als wären die Sterne des Himmels hineingefallen.
Und inmitten dieser gewaltigen Freilichtbühne sitze ich und
staune - atemlos. Der Monte ist das Paradies auf Erden - und die
Hölle. Man muß ihn hassen und lieben.
Die
Estancia Kattuaya, Außenposten der Zivilisation
Den folgenden
Tag marschieren wir durch lichteren Monte, der uns nicht mehr das
letzte abfordert, wir queren etliche Bäche, in denen wir unseren
Durst stillen können, die Macheten gebrauchen wir nur noch
selten. Nach Tagesmitte ermöglicht uns ein halb zugewachsener
Trampelpfad aufrecht zu gehen. Paolino und ich hören hoch oben
im Geäst einen Chorro-Affen schnattern, bevor wir ihn sehen
können wirft er uns erschrocken eine angeknabberte Frucht vor
die Füße und haut ab. Hier wird gejagt, deshalb das Mißtrauen!
Bald werden wir Menschen treffen, Neuigkeiten erfahren, andere Gesichter
sehen. Wir sind richtig aufgeregt.
|
| |
Ein
wunderschöner Schmarotzer. Eine Epiphyte besiedelt einen alten
Ast.
|
|
|
| |
|
|
Grüne Hölle
oder Paradies? Unbekannte Blütenpracht in den Tiefen des Waldes. |
|
| |
Dreißig
Minuten später bestaune ich einen hohen, in Reih und Glied
gepflanzten Bambuswald. In der Wildnis wächst alles scheinbar
zufällig durcheinander, jede von Menschenhand geschaffene Ordnung
fällt dem sensibel gewordenen Auge sofort auf. Gleich hinter
dem Bambus betreten wir eine Bananenpflanzung und sehen eine von
Moskitos umschwärmte Muttersau mit drei Ferkeln. Wir sind in
Kattuaya, einer kleinen Farm am Waldrand. Die 70-jährige Frau
Yanaguaya begrüßt uns ohne Furcht, sie kennt mich. Ihr
Sohn José ist zum Arbeiten in die weit entfernte Goldmine
Loricani gegangen. Außer der alten Frau und ihrem 19-jährigen
Sohn wohnt hier niemand. Für einen jungen Burschen wie José,
der auf Kattuaya lebt wie Robinson, muß Loricani schlimm sein.
Aber Gold zu schürfen ist für ihn und viele andere die
einzige Möglichkeit, sich Geld zu verdienen, Fluch und Segen
in einem. Ohne daß sie mich darum bittet drücke ich der
kleinen, alten Frau 20 Bolivianos in die riesigen verarbeiteten
Bratpfannenhände. Mit wieselflinkem Raubtierblick blitzen mich
ihre braunen Mandelaugen an, ein kurzes, überraschtes Lächeln
huscht über ihr Gesicht. >Für die Benutzung deiner
Wege.<, erkläre ich ihr meine Geldspende, die wirklich kein
großes Opfer für mich ist. Mit einer Flinkheit, die man
einer alten Frau nicht zutraut, verschwindet sie im Haus und kommt
mit einer großen Schüssel voll Obst und sättigenden
Valusa-Wurzeln heraus, die sie wortlos vor uns hinstellt. Wir schlagen
uns den Bauch voll bis wir nicht mehr können.
|
| |
Der
Autor mit Paulinho und Braulio in Kattuaya, einer winzigen, sich selbst
versorgenden Farm im Outback Boliviens.
|
|
|
| |
|
|
Hier in Kattuaya
wachsen unter anderem Bananen, die, wie auch andere Pflanzen, der
Selbstversorgung dienen. |
|
| |
Von
Frau Yanaguaya erfahren wir, daß von dem Goldgräberort
Chussi wegen mangelnder Ergiebigkeit der Minen keine regelmäßigen
Jeepkonvois mehr in die Minenmetropole Guanay fahren. Der einzige
sichere Transport sei Sonntags um acht Uhr morgens. Wir rechnen
nach, Sonntag, ist das nicht morgen? Ja, tatsächlich. Nach
Chussi habe ich von Kattuaya aus noch zwei Tage gemütliche
Gehzeit veranschlagt. Ich entschließe mich kurzerhand zu einem
nächtlichen Sprint, über 80 Kilometer, um den Jeep nicht
zu verpassen. |
| |
Nächtlicher
Gewaltmarsch nach Chussi
Frau Yanaguaya
bekocht uns wie eine Mutter, ganz offensichtlich hat sie große
Freude an unserem unersättlichen Hunger. Beiläufig erwähnt
sie, daß ihr der Sohn doch recht fehlt, er ist bereits zwei
Monate fort. Sie muß sehr einsam sein.
Um 21:00 Uhr
verabschiede ich mich von Juan-Carlos und Braulio, die auf Kattuaya
zurückbleiben werden und krieche mit Paolino ins Einmannzelt,
um schnell noch ein bißchen zu schlafen. Um 23:30 Uhr reißt
mich der Wecker hoch, momentan weiß ich nicht, wo ich bin,
ich habe geträumt. Die Habseligkeiten sind schnell verpackt,
zu Frühstücken brauchen wir nicht, weil wir erst vor zweieinhalb
Stunden zu Abend gegessen haben. Wir betrachten den vollgesichtigen
Mond, der silbriges Licht auf die Bananenpflanzung giesst. Nachtwind
lebt auf und eine Prozession weißer Wolken, schnell wie große,
schneeweiße Vögel, verdunkeln bald das Gesicht des Mondes,
bald lassen sie ihn zauberhaft hell erscheinen. Die schnell dahinziehenden
Wolken erwecken den Eindruck, als würde der Mond selbst über
die Baumkronen gleiten. >Laß uns gehen!<, mahne ich
Paolino zur Eile, wir setzen uns in Bewegung.
Zunächst
steckt mir der lange, gestrige Tag in den schweren Beinen, doch
sobald sie warm sind, ist die Müdigkeit verflogen. Wir trotten
in schneller Schrittfolge einen steilen Hang hinauf, bald perlt
Schweiß auf der Stirn. Über die Pforte eines von den
Yanaguaya’s freigehackten Tunnels betreten wir erneut den
Wald, in den das Mondlicht nicht eindringt. Es ist so dunkel, daß
wir Pflanzen nicht von Bäumen und Steinen unterscheiden können.
Man sieht nichts, was nicht direkt vom begrenzten Lichtstrahl der
Taschenlampe erleuchtet ist: Stundenlang bewegen wir uns in einem
kleinen, engen Lichttunnel, dessen schwarze Wände sich ständig
nach vorne ausdehnen und hinter uns wieder schließen. Der
begrenzte innere Tunnel wird durch den äußeren Vegetationstunnel
erneut begrenzt - ein Universum im Universum. Wir steigen vom Äußeren
ins Innere, vom Inneren ins Innerste Innere einer anderen Realität.
Hinter mir spüre ich Paolino’s schweren Atem, wir sprechen
nichts. Die Nacht reduziert die Außenwelt auf ein Minimum,
wir sind völlig für uns selbst und ich bewege mich gedanklich
so weit weg, wie zu keinem anderen Zeitpunkt der ganzen Reise. Plötzlich
entdecken wir silbernes Licht am Ende des Tunnels, unvermittelt
gelangen wir von der mikroskopischen Buschwelt hinaus ins freie
Grasland. Ein anderer Spiegel der Seele öffnet sich und reflektiert
Eindrücke: Ein weiter, freier Blick, getaucht in silbernes
Mondlicht. Wir trotten eine Stunde oder drei bis der Pfad von Kattuaya
auf den >Weg des Goldes< trifft. Schwarze Wolken rotten sich
zusammen, um den Mond einzuschüchtern. Einen Augenblick lang
stehen sich Wolken und Mond direkt gegenüber, dann schieben
sich die Wolken vor den Mond, es wird mit einem Schlag dunkel.
Wir lassen uns
dadurch nicht aufhalten, auf dem relativ guten Weg des Goldes, der
nach Chussi führt, können wir das Tempo sogar noch forcieren.
Die Nacht hat einen großen Vorteil: Es ist nicht so heiß
wie tagsüber. Wir passieren die Mine La Hoya, die Brücke
über einen Seitenfluss wurde weggeschwemmt und nicht ersetzt
- ein Zeichen dafür, daß die Mine kaum Gold fördert.
Der Bergbau in Bolivien stagniert, viele Schürfer werden arbeitslos
- nicht nur in La Hoya. Auch mein Begleiter Paolino ist ein arbeitsloser
Goldgräber, der sich um die Zukunft sorgt.
Hinter einer
Wegbiegung finden wir ein provisorisches Plastikplanenzelt mit zwei
schnarchenden Schläfern, an den Bäumen haben sie zwei
Kühe angebunden. Wir nähern uns harmlos pfeifend, um niemanden
zu erschrecken. Wie von einem tollwütigen Hund gebissen fährt
der erste hoch, entsetzt schreit er, >Scheisse!<. >Verdammt
was ist los, verflucht, was passiert denn hier?<, wacht jetzt
auch der andere auf. In ihrer heillosen Panik verfangen sie sich
in der Plane wie in einem Spinnennetz. Schnell können wir sie
davon überzeugen, daß wir keine mordenden Viehdiebe,
sondern harmlose Wanderer sind. Sich mitten auf einem durchaus auch
nachts begangenen Weg zu legen ist selten dämlich, noch dazu
mit zwei wertvollen Kühen. Die Kühe sind für Chussi
bestimmt, wo sie nach ihrer Ankunft geschlachtet werden, um den
Fleischbedarf der Goldgräber zu decken. Solche Viehtriebe,
große wie kleine, gibt es viele, die Goldgräber haben
Geld - solange sie etwas finden!
|
| |
|
|
Wir haben es
fast geschafft: Morgenrot vor erreichen von Chussi. |
|
| |
Chussi
bedeutet Menschen, Elektrizität, leichte Mädchen - Die
Annehmlichkeiten der Zivilisation. Aber Jeep ist keiner da! Am folgenden
Tag hat mich Paolino mit anderem Ziel verlassen, ich sitze in Chussi
fest. Naja, es läßt sich hier aushalten. Wenn du etwas
lernst in Bolivien, dann ist es Geduld. |
| |
Die
belebte Hauptstraße von Chussi.
|
|
|
| |
 |
 |

|
Letzte Aktualisierung: 18.01.06
|
|

